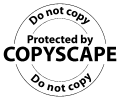©Hrycyk Architekten GmbH
Beispiel Langbau als Hofanordnung _ Kinder -& Familienzentrum Arche Noah Weißenburg in Bayern
Typologien beim Bau eines Kinderhauses
Der Neubau eines Kinderhauses auf der grünen Wiese hat städtebaulich andere Rahmenbedingungen als ein entsprechendes Projekt, das in einer innerörtlichen Struktur entwickelt wird. Hier unterscheidet sich auch das urbane vom ländlichen Umfeld deutlich. Umso dichter die umgebende Bebauung, je eher wird das Kinderhaus in einem größeren Gebäudekomplex mit verschiedenen Nutzungen zu integrieren sein oder als singuläre Nutzung zumindest auch mehrgeschossig gebaut werden. Bei einer Umnutzung eines bestehenden Gebäudes sind ebenso wie bei einer Sanierung und eventuellen Erweiterung im Bestand die Rahmenbedingungen deutlich mehr vordefiniert. Beim Neubau eines Kinderhauses können abhängig von der Erschließung der Gruppenräume und somit auch vom pädagogischen Konzept drei Grundtypen unterschieden werden.
1) Langbau als Reihung an Flurerschließung
Bei der am häufigsten vorkommenden Typologie werden die Gruppen entlang eines Flurs linear aneinandergereiht. Der Baukörper entwickelt sich dadurch länglich und hat eine einheitliche Orientierung aller Hauptnutzräume. Eine vorgelagerte Balkonstruktur als sicherer Fluchtweg, überdachter Freispielbereich sowie als permanenter Sonnenschutz bietet sich hier bei einer mehrgeschossigen Anordnung an. Bei einer ebenerdigen Einrichtung kann analog eine Überdachung vorgesehen werden.
Weiterhin sind hier mehrere Unterformen möglich - primär bedingt durch die Anordnung der gemeinsam genutzten Bereiche wie der Verwaltung und Küche. Durch die Organisation in einem Kopfbau bleibt der Langbau im Verhältnis schlank und die Funktionen werden eher nur einhüftig organisiert, so dass der Flur eine durchgehende Belichtung bekommen kann. Städtebaulich ergibt sich eine klare Orientierung und der Garten wird abgeschirmt. Der Grundstücksbedarf ist dadurch allerdings größer als bei einer zweihüftigen Organisation, bei der die weiteren Nutzräume gegenüber den Gruppenräumen angeordnet werden. Dadurch wir die Einrichtung verhältnismäßig kompakter und benötigt nur eine minimierte Grundstücksgröße, wobei aber die städtebauliche Ablesbarkeit der Funktionen reduziert ist.
Für die Belichtung der Flurzone müssen vor allem bei größeren Einrichtungen hier Aufweitungen, möglicherweise für die Garderoben, geschaffen werden, um die Flurzone mit Tageslicht zu versorgen. Die Möglichkeiten der weiteren Ausformulierung sind mannigfaltig. Gerade bei sehr großen Einrichtungen kann durch einen zweiten Gebäudeflügel eine Hofanordnung entstehen, wobei sich die Gruppenräume dann nach außen orientieren. Ebenso ist eine Kombination einer ein- sowie zweihüftigen Anordnung übereinander mit versetzten Flure möglich, so dass in den Spielfluren immer wieder Lichthöfe und Verbindungen zwischen den Ebenen entstehen können.
©Hrycyk Architekten GmbH
Beispiel Hallentyp _ Kindergarten St. Laurentius in Neustadt a. a. Donau Typologien beim Bau eines Kinderhauses
2) Hallentyp um Marktplatz
Die Gruppenräume orientieren sich hier um das Zentrum als zentrale Erlebnishalle. Hier ist auch die offene Treppe angeordnet und die Typologie ermöglicht den Kontakt zwischen allen Kindern des Hauses. Die Auslegung bietet sich für Einrichtungen von vier bis sechs Gruppen sowie als zweigeschossige Gebäudeform an und leistet einen sehr atmosphärischen Gemeinschaftsraum in der Mitte. Da der Baukörper zumindest annähernd quadratisch und daher städtebaulich nicht gerichtet ist, steht er als Solitär auf dem Baufeld.
Eine allseitig vorgelagerte Balkonstruktur ist zwar möglich, führt aber zu einer erheblichen Vergrößerung des Bauvolumens, da zumeist die Gruppenräume nur zweiseitig und zu den anderen Seiten die allgemeinen Nutzräume angeordnet sind. Deshalb sind für die Sicherstellung des zweiten Rettungswegs zwischen den Gruppenräumen angeordnete, lineare Treppen oder Bypasslösungen, die zu einer zusätzlichen in die Struktur integrierte Fluchttreppe führen, üblich. Als Unterform des Hallentypus, wohl primär im urbanen Umfeld, ist eine Überlagerung der beiden erforderlichen Rettungswege im Zentrum zu betrachten, mit der auch mehr als zwei Ebenen als maximal kompakte Einheit realisiert werden können.
Die innere Zone beherbergt die übereinander angeordneten, einläufigen Treppen und darum gruppieren sich an einem zur Treppenhalle abgetrennten Flurbereich die Nutzräume. Der Kontakt zwischen der horizontalen zur vertikalen Erschließungsebene ist hier nur noch visuell, aber nicht mehr akustisch möglich.
3) Additive Einzelkörper oder -formen
Nicht die Erschließungsform, sondern ein einzelner Baukörper oder eine Grundform bildet hier die Basis der Entwurfskonzeption. Additiv wird das einzelne Modul zusammengefügt, frei oder im festen Rasterfeld und der Erschließungsweg passt sich dann dieser Struktur untergeordnet an. Am häufigsten bei dieser Typologie ist als Grundform die Adaption eines archetypischen Hauses mit Satteldach und mit freien Stellung zueinander anzutreffen. Mit dieser kleingliedrigen Bauweise kann hier eine hohe Identifikation und gute Orientierung für die Kinder ermöglicht werden. Bedingt durch die allgemeine Erfordernis von zwei baulichen Rettungswegen ist dieser Ansatz eher ebenerdig ausgelegt.
©Hrycyk Architekten GmbH
Beispiel additive Bauform _ Kinderhaus Kurlandstraße Lauingen
Sebastian Hrycyk ist seit über 20 Jahren im Bereich der Planung und des Baus von Gebäuden für Kinder tätig. Seit 2010 hat er sein eigenes Architekturbüro mit dem Fokus auf öffentliche Bauten, nahezu ausschließlich als Holzkonstruktionen. Er plante mehr als 20 Kinderhäuser und er ist Referent auf der Fachkonferenz „Bau und Betrieb von Kitas“ am 16./17. Juli 2024 in München.
„Bau und Betrieb von Kitas“ am 16./17. Juli 2024 in München
DIE THEMEN
Die Kita als kindliche Lern- und Lebenswelt
Raumbezogene Qualitätsanforderungen
Neue Raumkonzepte für Kindertageseinrichtungen
Der Raum als dritter Pädagoge
Einbindung der Nutzer in den Planungsprozess
Wie guter Kita-Bau pädagogische Arbeit und Betriebsführung unterstützt
Nachhaltigkeit
Ganzheitliche Energiekonzepte
Sicherheit & Akustik
Sichere Gestaltung von Gebäuden und Freiflächen
BESICHTIGUNG
Haus für Kinder: Sanierung und Erweiterung
INTERAKTIV
Workshop: Nachhaltiges Bauen
Deep Dive: Kita gut planen
Reflexion & Inspiration
Datum: 16.07.2024 - 17.07.2024
Ort: Design Offices München Atlas
Rosenheimer Str. 143C
81671 München
Ihr besonderes Plus: Abonnenten der competitionline aus Architektur- und Planungsbüros erhalten 100,- € Rabatt auf diese Konferenz. Nutzen Sie bei Anmeldung den Code „C100“ um von dem Rabattangebot zu profitieren.
Weitere Artikel
Gewährleistung
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.